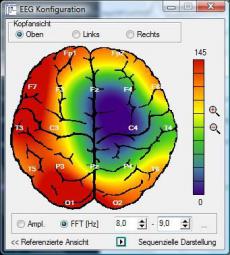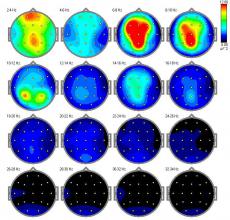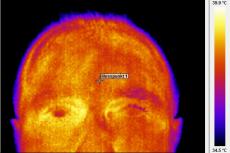Traumatherapie: erhöhtes PTBS-Risiko bei Ängsten
Haben Angspatienten ein erhöhtes PTBS- Risiko?
Menschen mit chronischen Ängsten haben ein erhöhtes Risiko, an einer PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) zu erkranken.
In einem früheren Artikel haben wir bereits von Forschungen berichtet die Hinweise darauf gaben, dass es genetische Zusammehänge in Bezug auf die PTBS gibt.
Siehe auch Traumatherapie: Genetische Zusammenhänge bei PTBS
Doch woran erkennt man potenzielle Risikopatienten im Praxisalltag und auf wen sollte man als Therapeut besonders achten, wenn bspw. ein größeres Unglück geschehen ist?
Inzwischen gibt es neue interessante Forschungen auf diesem Gebiet:
Naomi Breslau, Professorin für Epidemiologie an der Michigan State University (MSU) hat hierzu eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Klienten mit chronischen Ängsten (also auch bspw. Klienten, die sich ständig Sorgen machen) und depressiven Tendenzen eine erhöhte Anfälligkeit für PTBS haben.
Breslau kam zu diesen Erkenntnissen, indem sie die Daten einer über mehr als 10 Jahre andauernden Studie mit über 1000 zufällig ausgewählten Menschen aus südost Michigan analysierte.
Zu Beginn der Studie beantworteten die Teilnehmer 12 Fragen, deren Ziel es war, mögliche "neurotische" Tendenzen abzuschätzen (vor allem in Bezug auf Ängste, Depressionen und einer Neigung zur Überreaktion bei alltäglichen Problemen oder Enttäuschungen). Anschließend wurden die Teilnehmer nach 3, 5 und 10 Jahren erneut befragt.
Die Hälfte der Teilnehmer erlebte in der Zwischenzeit traumatische Ereignisse. Diejenigen, die auf der Neurotizismus-Skala zu Beginn der Studie höhere Punkte erzielten (also "neurotisch veranlagt" waren) gehörten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu den 5%, die in Folge traumatischer Erlebnisse eine PTBS entwickelten.
Breslau sieht das Überzeugende in der Studie vor allem darin, dass die Persönlichkeit der Teilnehmer schon vor dem Erleben des traumatischen Erlebnisses analysiert wurde, anstatt dass der Neurotizismus erst im Anschluss an ein Trauma gemessen wird (was dann im Zweifel keine Rückschlüsse mehr auf die Basis-Persönlichkeit zulässt, da alle Auffälligkeiten vom Trauma stammen könnten).
Laut Breslau ist es schwierig, einer PTBS vorzubeugen, aber ihre Erkenntnisse können Therapeuten dabei helfen, Menschen zu erkennen, die ein erhöhtes Risiko haben und schnell zu reagieren, wenn diese ein Trauma erleben.
"Wir müssen auf Menschen mit vorherigen psychiatrischen Erkrankungen achten, wenn sich eine Katastrophe ereignet", sagt sie. "Das wichtigste ist, dass die Therapeuten dann nach ihren Patienten sehen und ihnen die entsprechende Fragen stellen".
Für Therapeuten in der Privatpraxis heißt das, dass sie vor allem darauf achten sollten, wie es Klienten, von denen sie wissen, dass sie zu Ängsten, Depressionen, ständigen Sorgen oder Überreaktionen neigen geht, wenn sich in deren Leben ein entsprechender Vorfall ereignet hat (Unfall, Tod eines angehörigen, Gewalt, ein Unglück im näheren Umfeld etc.).
Darüber hinaus sind Naomi Breslaus Erkenntnisse natürlich ein Denkanstoß, Traumapatienten nicht mehr nur ausschließlich als Traumapatienten, sondern auch als Persönlichkeiten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon vor der PTBS (ggf. durch genetische Einflüsse) emotional beeinträchtigt waren zu erkennen und den Klienten und seine Symptome ganzheitlicher zu betrachten, indem man gezielt erfragt, welche Symptome nun konkret durch das Trauma verursacht wurden allzu oft werden bei Klienten mit PTBS nämlich alle Symptome auf das Trauma zurückgeführt und das Vorhandensein vorheriger Symptome ggf. ignoriert (Erfahrungen von Klienten aus unseren eigenen Praxen, die sie uns berichteten), was ungünstigsten Falls zu entscheidenden Fehlern in der Therapieplanung führen kann.
Insgesamt sind diese Erkenntnisse aus hypnotherapeutischer Sicht ein weiterer Hinweis, vorsichtig mit vorschnellen Regressionen bei PTBS-Patienten zu sein wenn das Trauma bereits vorhandene Neurotizismen getriggert und verstärkt hat, ist auch eine Rückreise zu einem anderen Zeitpunkt nur wenig Erfolg versprechend, da es sich hier nicht mehr nur um einen konkreten Auslöser, sondern um eine komplexere Konstellation handelt.
Eine stabilisierende, zukunftsorientierte Arbeit "vom Trauma weg", also mit Fokus auf gute Gefühle und Zielvorstellungen anstelle andauernder Wiederholung der traumatischen Inhalte, durchaus auch unter Einbezug eventueller Vorerkrankungen wäre in diesen Fällen vermutlich deutlich Erfolg versprechender.
---
Quelle der Informationen über die Studie von Naomi Breslau: Michigan State University (MSU)